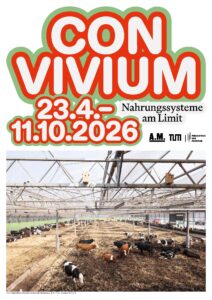CONVIVIUM
Nahrungssysteme am Limit
Die sichere und gerechte Versorgung der Weltbevölkerung mit Nahrung hängt von einem System globaler Netzwerke ab: Bäuer:innen, Fischer:innen, Züchter:innen, Händler:innen, Transportunternehmen, Märkte und industrielle Verarbeitungsbetriebe produzieren und vertreiben nicht nur das, was für die menschliche Ernährung notwendig ist. Sie werden durch die kapitalistische Wachstumslogik motiviert, immer mehr Produkte zu produzieren, die durch Überkonsum zu falscher Ernährung und zu einer massiven Verschwendung von Nahrungsmitteln führen. Doch dieses System kommt durch Klimaerwärmung, politische und ökonomische Faktoren immer mehr an seine Grenzen. Viele Meere sind bereits überfischt, fruchtbare Ackerböden werden überbaut oder erodieren und ganze Landstriche verwüsten, weil es nicht genug Regen gibt. Zugleich trägt die Nahrungsproduktion selbst durch den wachsenden Co2-Ausstoss massiv zum Klimawandel bei – ein Teufelskreis, der immer sichtbarer wird. Kaum ein Land der Erde kann seine Bevölkerung noch aus eigenen Ressourcen ernähren.
Die Ausstellung präsentiert in zwölf Kapiteln anschauliche Beispiele dafür, wie unsere Lebensmittel heute produziert und vertrieben werden. Der Blick richtet sich vor allem auf Europa, doch die globalen Zusammenhänge werden stets einbezogen. Ziel der Ausstellung ist es, für die Besucher:innen sichtbar zu machen, welche räumlichen und technischen Grundlagen es für unsere Nahrungsproduktion gibt – und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für die Zukunft ergeben.
1. Klima als Dienstleistung. Die Niederlande gelten als die Vorreiter für die Entwicklung von High-Tech-Gewächshäusern. In einem exakt kontrollierten Klima wachsen Gemüse, Obst und Kräuter das ganze Jahr über, unabhängig von Wetter und Jahreszeit. Die ausgeklügelte Technologie dahinter ist selbst zu einem erfolgreichen Exportprodukt geworden und macht aber gleichzeitig dem normalen, natürlichen Anbau Konkurrenz.
2. Die Erdbeere und das Gewächshaus. Wie viele andere Früchte ist auch die Erdbeere heute fast das ganze Jahr über in Supermärkten erhältlich. Ein zeichnerischer Essay zeigt, welche Konsequenzen diese ständige Verfügbarkeit für die regionalen Produzent:innen im Raum München hat.
3. Der Lachs und die Tomate. Die Lachszucht ist zu einer globalen Industrie aufgestiegen. Doch ihr Wachstum hat einen hohen Preis: Für das Futter der Zuchtfische wird wild gefangener Fisch zu Fischmehl verarbeitet. Durch Überfischung ist die lokale Kleinfischerei einiger Küstenregionen in Westafrika zusammengebrochen. Viele Menschen verlieren dadurch ihre Lebensgrundlage und werden in die Migration auf die Kanarischen Inseln getrieben. Viele, die die gefährliche Überfahrt überleben, landen als Schwarzarbeiter – illegal und unter prekären Bedingungen – in den Gewächshäusern der Tomatenproduktion von Almería.
4. Tropicalia. Auf Sizilien sind die Folgen des Klimawandels schon heute dramatisch spürbar. Hitze, Dürre und unberechenbare Wetterextreme setzen der Landwirtschaft stark zu. Mit neuen Weizensorten und dem Anbau tropischer Früchte suchen Landwirt:innen nach Wegen, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen.
5. Das Tier ist anwesend. Der moderne Kuhstall ist ein Paradebeispiel für die zunehmenden Widersprüche und Absurditäten der heutigen Nahrungsproduktion. Digitale Steuerungssysteme, genetische Züchtungen und Reproduktionstechnologien bestimmen den Wettlauf um immer mehr Milch und Fleisch. Die Tiere werden auf maximale Leistung designt und sind in diesem System selbst nur noch (lebende) Maschinen – und der Landwirt ist zum Manager von vordefinierten Programmen und Robotik mutiert.
6. Technominotaurus. Eine Installation des ungarischen Künstlers und Forschers Daniel Szálai thematisiert die meist unsichtbare Rolle der Zuchtbullen als Träger genetischer Information. Die multimediale Installation verdeutlicht die Körperlichkeit und mythische Dimension der männlichen Tiere.
7. Oktopus-Choreographien. Am Beispiel der kleinen Küstengemeinde Angeiras im Norden Portugals wird die Arbeit und Produktionskette der lokalen Fischer:innen gezeigt. Neben Dorsch, Wolfsbarsch, Garnelen und Hummer fangen sie vor allem große Mengen an gewöhnlichem Oktopus. Der wachsende Fischbedarf durch den Tourismus kann aber in der Region längst nicht mehr gedeckt werden – doch der Oktopusfang hinterlässt deutliche Spuren in der gebauten Umwelt.
8. Mönche und Maschinen. Schon seit dem Mittelalter prägt die Karpfenzucht einen Teil der Kulturlandschaft in Bayern. Heute entstehen mit moderner Indoor-Aquakultur neue Formen der Fischzucht – sogar Meeresfrüchte wie Garnelen können nun im Binnenland gezüchtet werden. Neue Technologien versprechen mehr Effizienz und kürzere Transportwege für Produkte, die von immer mehr Konsumenten gekauft werden.
9. Hinterglobes. Damit die Menschen weltweit immer mehr Fleisch verspeisen können, müssen riesige Flächen für den Anbau von Tierfutter bereitgestellt werden – oft weit entfernt von den Orten, an denen die gigantischen Mengen von Rindern, Schweinen und anderen Tieren leben oder das Fleisch konsumiert wird. Das Konzept „Hinterglobes“ macht die territorialen Abhängigkeiten der Nahrungsproduktion sichtbar.
10. Soyscapes. Die weltweit steigende Nachfrage nach Soja – vor allem als Futtermittel für die Tierhaltung eingesetzt – bleibt die zentrale Ursache für die fortschreitende Abholzung des Regenwaldes in Brasilien. Ein zeichnerischer Essay geht den oft undurchsichtigen Produktions- und Lieferketten nach Europa nach.
11. Die ukrainische Getreidekette. Die Ukraine hatte sich bis 2014 zu einer Supermacht der globalen Getreideproduktion entwickelt. Dieses Kapitel analysiert, wie der russische Angriffskrieg gezielt Silos, Bewässerungssysteme und Felder zerstört, mit Minen verseuchte Böden hinterlässt und damit auch die UN-Hilfsprogramme in Krisenregionen bedroht.
12. Lebendige Böden. Böden sind die fundamentale Grundlage fast aller Nahrungssysteme – ein lebendiges Geflecht aus Mikroorganismen, das Nährstoffe recycelt, Wasser filtert und Kohlenstoff speichert. Doch durch Überbauung, Überdüngung und Erosion schwindet die existenziell wichtige, aber auch limitierte Schicht der Erde unaufhaltsam – und mit ihr die Basis unserer Ernährung.
Kurator:innen und Projektmanagement: Andjelka Badnjar, Andres Lepik
Co-Kurator:innen für den Ausstellungsteil Das Tier ist Präsent: Victor Muñoz Sanz, Sofia Nannini
Fachliche Beratung für den Ausstellungsteil Lebendige Böden: Stiftung Kunst und Natur; Netzwerk der Boden-Initiative und des Forum Nantesbuch der Stiftung
Assistenz-Kuratoren: Stefan Pielmeier, Bram Terwogt, Pauline Ludwig
Öffentliches Programm: Dietlind Bachmeier
Ausstellungsdesign: Amelie Steffen, Maximilian Atta, Jan Müller
Ausstellungsinstallationen – Materialforschung und -entwicklung: Niklas Fanelsa, Öykü Tok
Grafikdesign: strobo B M Visuelle Kommunikation/ Julian von Klier, Sabrina Baumann, Matthias Friederich
Filme: Nicole Humiński, Nikolai Huber
Sommerküche Konzeption und Design: Tillmann Gebauer, Sebastian Zitzmann, Alice Ianakiev
FÖRDERUNG/ KOOPERATIONEN
PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e.V. und den Kooperationspartner der Allianz
JEF - Not a Foundation
Stiftung Kunst und Natur
Department of Architecture and Design, Politecnico di Torino
istraw
BSR BPR Dr. Schäpertöns Consult
Spinder Dairy Housing Concepts
PRIVA Creating a Climate for Growth
Bayerischer BauernVerband
Oceanloop
Schurr Gerätebau GmbH
Freundeskreis Architekturmuseum TUM
Publikation
Die Ausstellung wird begleitet von einer umfassenden Publikation, die zentrale Themen der Ausstellung durch Essays und Bildbeiträge vertieft.
Herausgeber:innen: Andjelka Badnjar und Andres Lepik
Mit Beiträgen von: Grace Abou Jaoude, Maximilian Atta, Andjelka Badnjar, Sepp Braun, Giulia Bruno, Jean-Marc Caimi, Neal Haddaway, Diego Inglez de Souza, Natalie Judkowsky, Nikos Katsikis, Andres Lepik, María D. López Rodríguez, Jan Müller, Víctor Muñoz Sanz, Sofia Nannini, Raj Patel, Valentina Piccinni, Olga Pindyuk, Stefan Pielmeier, Réka Rozsnyói, Tiago Saraiva, Gent Shehu, Katrin Schneider, Dániel Szalai, Amelie Steffen, Carolyn Steel, Rafael Sousa Santos, André Tavares, Mark Titley, José Luis Vicente Vicente, und Sinan von Stietencron.
27,5 × 22 cm, ca. 256 Seiten, 150 Abbildungen.
Gestaltung: strobo B M
Produktion und internationaler Vertrieb: ArchiTangle, Berlin
Die Ausstellung wurde von einer Reihe von Masterprojekten und Seminaren am Lehrstuhl für Architekturgeschichte und Kuratorische Praxis begleitet.
Closing the Circle. About Food and Spaces WS 2024/2025
About Food and Space(s). Exhibit Design (Film) SS 2025